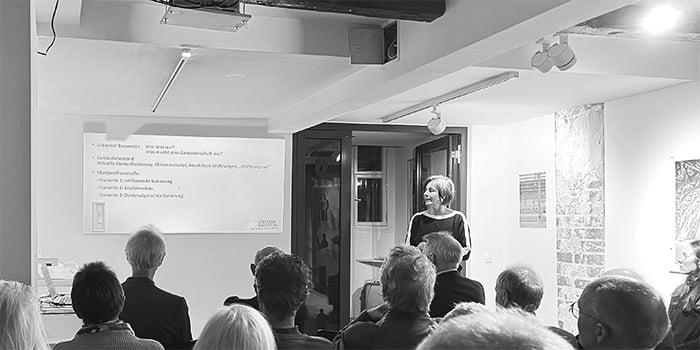
Dialog über die Zukunft des Baudenkmals
Am Mittwoch, den 8. Oktober lud das ArchitekturForumLübeck zu einem mitgliederinternen Turnus ein, um in einen Dialog über die Zukunft eines denkmalgeschützen Wohnhauses in der Margarethenstraße
einzutreten.
Zu unserer Freude war Christine Koretzky – Vorständin des Lübecker Bauvereins – an diesem Abend zu Gast, um uns Einblicke in die Perspektive des Bauvereins zu geben und stand für einen offenen
Austausch zur Verfügung.
Der Anlass, den Umgang mit dem Baudenkmal Margarethenstraße auf die Tagesordnung zu setzen, war die Berichterstattung der Lübecker Nachrichten, nach der der Bauverein bei der zuständigen Denkmalbehörde einen Abbruchantrag eingereicht hat.
Das Baudenkmal Margarethenstraße 42-52
Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus ist mit der Objektnummer 4127 in die Denkmalliste der Hansestadt Lübeck eingetragen. Das backsteinsichtige Gebäude aus den 1930er Jahren ist mit seinem
Flachdach und dem Verzicht auf jegliches Dekor ein Repräsentant des Neuen Bauens. Als Architekt wird Willy Berg genannt, allerdings ist die Quellenlage aufgrund des Verlustes der bauzeitlichen
Akten nicht eindeutig. Aus geschichtlichen und städtebaulichen Gründen erstreckt sich der Schutzumfang auf das Gebäude mit dem großzügigen Vorgarten und der rückwärtigen Grünfläche.
Städtebaulich wirksam zeigt sich die mehr als 10 Meter zurückspringende Bauflucht, die den Straßenraum der Margarethenstraße zum Hanseplatz öffnet. Die sachliche Formensprache wird begleitet von
einer ambitionierten Komposition ineinander geschobener Kuben sowie einem Wechsel aus verputzten und steinsichtigen Flächen. Die vier mittleren Treppenhäuser bilden als Einschnitte mit
Putzfassaden vertikale Zäsuren, die den Bau rhythmisch gliedern. Die äußeren Treppenhäuser sind im Bereich der jeweiligen Gebäuderücksprünge angeordnet, so dass die Hauseingänge über Eck in der
orthogonalen Straßenansicht nicht in Erscheinung treten, während sich die Treppenhausfenster in diesen Bereichen mit den angrenzenden geputzten Balkonbrüstungen zu horizontalen Akzenten
verbinden. Den oberen Abschluss des Gebäudes bildet ein Mezzaningeschoss mit einer Reihe kleinerer quadratischer Fenster. Die klare, aber gleichzeitig sorgfältig ausformulierte Architektursprache
liefert so ihren Beitrag für ein überzeugendes Straßenbild.
Die geschichtliche Bedeutung liegt in dem Zeugniswert für den am Gemeinwohl orientierten sozialen Wohnungsbau der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts und für die Architektur der Neuen
Sachlichkeit, die wenige Jahre später zum Feindbild der nationalsozialistischen Propaganda wurde.
Der Lübecker Bauverein eG
Die Wohnungsbaugenossenschaft, 1892 als Lübecker gemeinnütziger Bauverein gegründet und 1940 mit dem Bauverein Selbsthilfe zusammengeschlossen, trägt nach Aufhebung des
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1990 den Namen Lübecker Bauverein eG. Das Kerngeschäft bleibt die Bewirtschaftung, bauliche Instandhaltung und Modernisierung der fast 6000 Wohnungen im Bestand.
Die Aktivitäten als Bauträger umfassen auch den Neubau und die Vermarktung von Wohnungen in höheren Preissegmenten, wie die Wohnprojekte am Malerwinkel, am Klughafen und am Falkendamm, die damit
gerechtfertigt werden, dass Erträge wiederum der Modernisierung im Bestand zugutekommen. Dies gilt auch für den vorbildlich sanierten Friedrich-Ebert-Hof im Stadtteil St. Jürgen. Die 1931 vom
Bauverein Selbsthilfe mit den Architekten Willy Berg und Max Paasche errichtete Wohnanlage zeigt signifikante Parallelen zu dem aktuell diskutierten Baudenkmal an der Margarethenstraße.
Vortrag, Diskussion und Ausblick
Christine Koretzky erläuterte zunächst in einem kurzen Vortrag die erfolgten Untersuchungen und Planungen sowie die Perspektive des Bauvereins. Von Seiten des Bauvereins wird der Denkmalwert des Wohnhauses nicht in Frage gestellt. Nach der Auswertung von drei Szenarien, denkmalgerechte Sanierung, Modernisierung im Bestand ohne Rücksicht auf denkmalpflegerische Belange und Abbruch des Baudenkmals mit Ersatzneubau, wird vom Bauverein jedoch der Ersatzneubau favorisiert. Begründet wird der Ersatzneubau mit gravierenden Bauschäden, mangelndem Wärme- und Trittschallschutz und nicht mehr zeitgemäßen Grundrissen im Bestandsgebäude, vor allem aber seien Abbruch und Neubau wirtschaftlich geboten.
Im anschließenden Austausch mit dem Plenum wurden unterschiedliche Standpunkte deutlich. Einerseits gibt es Zustimmung zu der mit einem Neubau zu erwartenden Verbesserung der Wohnsituation, andere Stimmen betonen das öffentliche Interesse am Erhalt des Baudenkmals und beklagen die signifikanten Einbußen an städtebaulicher Qualität durch die Teilüberbauung der Vorgartenfläche und die ebenerdige Parkplatzanlage anstelle der hofseitigen Grünfläche. Zu bedenken ist, dass die Grenzen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit für die Erhaltung eines Kulturdenkmals nicht mit einem Anspruch auf wirtschaftliche Optimierung zu verwechseln sind. Die Situation, dass bestehende Förderszenarien den Abbruch eines Baudenkmals nahelegen, könnte auch ein Anlass sein, über die Rahmenbedingungen von Fördermitteln nachzudenken.
Es zeigt sich ein Plädoyer, mögliche Zwischentöne der vorgestellten Szenarien auszuloten und die unterstellte Polarität wie „Denkmalschutz oder Klimaschutz“ zu überwinden, indem die unterschiedlichen öffentlichen und die berechtigten privaten Belange gleichermaßen berücksichtigt werden. Von Interesse könnte ein bauhistorisches Gutachten sein, das die noch zu wenig erforschten Hintergründe der Planungs- und Bauzeit und der handelnden Akteure beleuchtet. Dabei bieten sich auch Vergleiche mit dem erwähnten Friedrich-Ebert-Hof in Lübeck St. Jürgen an. Ferner lohnt der Blick über die Stadtgrenzen zur AfA Siedlung in Bremen, die 1930 von den Architekten Willy Berg und Max Paasche gebaut wurde und nach Unterschutzstellung 1980 heute denkmalgerecht saniert ist. Für das Quartier Barmbeck Nord in Hamburg gilt seit 2018 eine Erhaltungssatzung, mit der einzelne bereits zu beklagende gestalterische Verluste durch Wärmedämmung und unpassende Fenster gestoppt werden konnten. In diesem Gebiet findet sich auch der denkmalgeschützte Wohnblock Habichtstraße von den Architekten Willy Berg und Max Paasche.
Die Bedeutung und Aktualität der Pionierleistungen im Wohnungsbau der 1920er und frühen 1930er Jahre, die in sozialer Verantwortung geplant und gleichzeitig als Protagonisten der Baukultur
realisiert wurden, wird nicht zuletzt darin deutlich, dass die Siedlungen der Berliner Moderne seit 2008 in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO geführt werden.
Im Anschluss an die interessante und rege Diskussion klang der Abend bei Snacks und Getränken aus und bot über den Dialog im Plenum hinaus Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch und für angeregte Gespräche.
Zu danken ist Christine Koretzky für ihr informatives Kurzreferat und die Bereitschaft zur Diskussion, die weder der denkmalrechtlichen Beurteilung und Entscheidung vorgreifen, noch Lösungen für
die komplexe Aufgabenstellung liefern konnte, aber als Anregung für eine konstruktive Nachdenklichkeit verstanden sein will.


